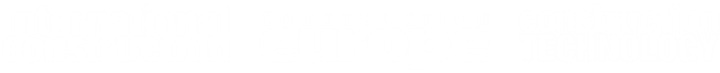Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Wasserstoff-Brennstoffzellen in Materialtransportgeräten
25 Juni 2024
Einer der beliebtesten Kraftstoffe zum Antrieb von Gabelstaplern ist Propan. Während eines kürzlich abgehaltenen Webinars des Engine Technology Forum über Propan-Autogas sagte Gavin Hale vom Propane Education & Research Center (PERC), dass Propan in den Vereinigten Staaten etwa 600.000 Gabelstapler antreibt.
Allerdings machen elektrische Energiequellen bei Gabelstaplern Fortschritte. Jacob Whitson von der gemeinnützigen Organisation CALSTART zitierte eine Marktforschung aus dem Jahr 2021, die darauf hindeutete, dass in den USA bis Ende 2029 fast 250.000 batteriebetriebene Elektrostapler verkauft werden.
Auch Elektrostapler mit Wasserstoffbrennstoffzellen gewinnen an Bedeutung. Ein Sprecher des US-Energieministeriums (DOE) teilte per E-Mail mit, dass derzeit in den USA mehr als 60.000 solcher Maschinen im Einsatz seien. Im November 2018 waren es laut dem damals veröffentlichten Fact of the Month des DOE noch 20.000.
Vielfalt im Materialtransport
Und das betrifft nicht nur Gabelstapler. Wasserstoff-Brennstoffzellen finden ihren Weg in eine Vielzahl von Materialtransportlösungen.
 Ein mit Brennstoffzellen betriebener Top-Pick-Containerstapler im Hafen von Los Angeles in Kalifornien. (Foto: Hyster)
Ein mit Brennstoffzellen betriebener Top-Pick-Containerstapler im Hafen von Los Angeles in Kalifornien. (Foto: Hyster)„Während die Verwendung moderner elektrischer Energiequellen wie HFCs (Wasserstoffbrennstoffzellen) oder Lithium-Ionen-Batterien im Allgemeinen bei kleineren Geräten mit geringerer Kapazität wie Gabelstaplern weiter ausgereift ist, ist anzumerken, dass die Verwendung von HFCs auch bei anderen Arten von Materialtransportgeräten zunimmt, beispielsweise bei Containertransportgeräten, die üblicherweise zum Transport von Schiffscontainern in Häfen verwendet werden“, sagte Lucien Robroek, Präsident von Global Technology Solutions bei der Hyster Company, per E-Mail.
„Tatsächlich gehören Anwendungen mit Containerumschlaggeräten zu denen mit dem größten Potenzial für HFKW“, sagte er. Dies liegt vor allem an der hohen Ladekapazität der Maschinen und der Notwendigkeit, praktisch rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Betrieb zu sein.
FCEV vs. BEV
Robroek sagte, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die bei der Materialhandhabung dazu beitragen, ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV) gegenüber einem Batterie-Elektrofahrzeug (BEV) zu wählen. Dazu gehören Energiequellen, Flottengröße, Fahrzeiten, verfügbarer Platz, Nachhaltigkeitsziele und das regulatorische Umfeld.
„Allgemein sind jedoch die zum Aufladen benötigte Zeit und die Zeit, die Geräte mit einer Ladung laufen können, seit jeher die größten Herausforderungen für die batteriebetriebene Stromversorgung bei Anwendungen mit hoher Kapazität und langen Arbeitszyklen“, so Robroek.
Er sagte beispielsweise, dass für Maschinen mit Verbrennungsmotor und Arbeitszyklen, die mehreren Acht-Stunden-Schichten entsprechen, die Umstellung auf eine batterieelektrische Lösung die Investition in zusätzliche Gabelstapler bedeuten könnte, um Maschinen auszutauschen, die zum Aufladen der Batterien vorübergehend außer Betrieb genommen werden müssen.
„Brennstoffzellen hingegen müssen nicht aufgeladen werden“, sagte Robroek. „Stattdessen füllen die Betreiber einen Tank mit Wasserstoff auf, ähnlich wie beim Auftanken eines Verbrennungsmotors.“
Er fügte hinzu, dass Innovationen bei batteriebetriebenen Elektromaschinen es möglich gemacht hätten, dass Gabelstapler volle acht Stunden lang betrieben werden könnten, bevor sie wieder aufgeladen werden müssten.
„Für Betriebe, bei denen die Lkw nicht über mehrere Schichten hinweg im Dauereinsatz sein müssen oder die Platz für eine größere Lkw-Flotte bieten können, könnte der batterieelektrische Betrieb eine gute Lösung sein“, so Robroek.
Netzstabilität
Eine weitere Herausforderung für batteriebetriebene Elektrogeräte stellt jedoch das Stromnetz dar. Laut Robroek muss hierfür die lokale Netzstabilität bewertet werden.
„Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht 29,5 kWh pro Tag“, sagte er. „Um dagegen eine Flotte von 100 Containertransportern mit einem 260-kWh-Akku einmal täglich aufzuladen, sind über 20.000 kWh erforderlich – ein Bedarf, der die Netzkapazität überlasten könnte.“
Bei kleineren Flotten, die über die Möglichkeit verfügen, über Nacht oder mit gestaffelten Ladezeiten zu laden, dürfte dies kein so großes Problem darstellen, insbesondere wenn das Netz stabil ist, so Robroek.
Tankinfrastruktur
Laut Robroek sind zum Betanken von FCEVs Wasserstofftankstellen vor Ort und – je nach Wasserstoffbeschaffungsstrategie des Unternehmens – auch Speichermöglichkeiten erforderlich.
„Wasserstoff kann an Lagerstätten und Tankstellen geliefert oder vor Ort erzeugt werden“, sagte er. „Die Menge an Wasserstoff, die ein Betrieb verbraucht, ist ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung, welche Methode der Wasserstoffbeschaffung sinnvoll ist.“
Wenn es beispielsweise darum geht, ein einzelnes Fahrzeug zu betanken, kann sich ein Unternehmen für kleinere Mengen einfach Wasserstofftankpakete oder für größere Mengen einen Schlauchanhänger liefern lassen, sagte Robroek. Die Wasserstofferzeugung vor Ort ist jedoch sinnvoll, sobald der Verbrauch 800 kg pro Tag übersteigt oder die Lieferentfernung zum Problem wird.
„Was die Handhabung und Lagerung von Wasserstoffbrennstoff betrifft, müssen die Betriebe ihn an einem sicheren Ort aufbewahren, der sauber und trocken ist, und die richtige Lagertemperatur und die richtigen Umgebungsbedingungen im Bedienungs- oder Wartungshandbuch nachlesen“, sagte Robroek. „Die Betriebe müssen außerdem alle Zündquellen im Umkreis von 25 Fuß des Lagerbereichs beseitigen und dürfen keine Heißarbeiten – Arbeiten, die eine offene Flamme erfordern – im Umkreis von 25 Fuß des Lagerbereichs durchführen.“
Bleiben Sie verbunden



Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.
Mit dem Team verbinden