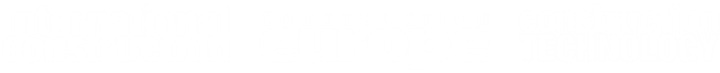Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Sind Netto-Null-Gebäude wirklich Netto-Null-Gebäude?
01 Dezember 2023
Es ist allgemein bekannt, dass Gebäude einen großen Anteil der weltweiten energiebezogenen Kohlendioxid-Emissionen verursachen: insgesamt 28 %.
Doch als die Staats- und Regierungschefs der Welt vom 30. November bis 12. Dezember zur 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen ( COP 28 ) in Dubai zusammenkamen, brachte ein neuer Bericht ein weiteres, ebenso unangenehmes Ergebnis zutage.
Von den vielen Gebäuden, die weltweit gebaut werden und als „Netto-Null-Gebäude“ angepriesen werden, sind nur sehr wenige tatsächlich in Betrieb.
Dies ist das Ergebnis eines Berichts des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurberatungsunternehmen Arup.
Die Autoren des Berichts warnen davor, dass ohne größere Fortschritte das UN-Durchbruchsziel für die gebaute Umwelt bis 2030 nicht erreicht werden könne. Dieses sieht vor, dass alle ab 2030 fertiggestellten neuen und sanierten Gebäude im Betrieb CO2-neutral sein sollen.
Tatsächlich haben die CO2-Emissionen von Gebäuden im Betrieb nach Angaben des UN-Umweltprogramms einen historischen Höchststand von rund 10 GtCO2 erreicht, was 5 % mehr ist als im Jahr 2020.
Laut Bericht ist gebundener Kohlenstoff ein relativ neuer Schwerpunktbereich. Bei betrieblichem Kohlenstoff besteht jedoch insofern ein Unterschied, als dass sich die Beteiligten aus technischer Sicht mit Energieeffizienz auskennen und technische Lösungen zur Verfügung stehen, um Gebäude mit Netto-Null-Emissionen in Betrieb zu nehmen.
Darin wird gewarnt: „Uns fehlt eine klare Richtung, um die notwendigen Verhaltensänderungen voranzutreiben, von den Investment-CEOs über die Lieferketten (Design, Bau und Betrieb) bis hin zu den einzelnen Bewohnern.“
Das Ergebnis: Trotz der steigenden Zahl von Unternehmen, die sich zu Netto-Null-Zielen verpflichten, gibt es:
- Keine weltweit einheitliche und robuste Definition eines Netto-Null-Gebäudes;
- Es gibt keine nationale Richtlinie, die vorschreibt, dass Gebäude jetzt oder in Zukunft wirklich klimaneutral sein müssen.
- Erhebliche Unterschiede bei den durch Branchenzertifizierungen festgelegten Netto-Null-Standards;
- Weltweit gibt es eine „unbedeutende Anzahl“ wirklich klimaneutraler Gebäude.
In dem Bericht heißt es, dass ein Nullenergiegebäude in der einfachsten Form als ein Gebäude definiert werden könne, das zu 100 Prozent durch eigene erneuerbare Energie vor Ort betrieben werde, doch sei dieses Ziel „für die überwiegende Mehrheit der Gebäude unerreichbar“.
Der WBCSD und Arup haben eine international vereinbarte Definition für Netto-Null-Gebäude gefordert, um eine strengere nationale und lokale Politik sowie Industriestandards anzustoßen.
Sie fordern zudem eine stärkere Unterscheidung zwischen Gebäuden, die in der Lage sind, ein Netto-Null-Ziel zu erreichen, und solchen, die nachweislich betriebsmäßig ein Netto-Null-Ziel erreichen.
Um als Netto-Null-Gebäude eingestuft zu werden, müssen die Gebäude:
- Seinen Energiebedarf ausreichend reduziert haben, um mit der Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien in dem Markt, in dem es tätig ist, vereinbar zu sein;
- In der Lage sein, zu 100 % mit erneuerbaren Energiequellen (Strom/Wärme) zu arbeiten;
- Kaufen Sie 100 % erneuerbare Energie über einen Tarif oder einen Stromabnahmevertrag, der „nachweislich zusätzlich“ zu den nationalen Verpflichtungen in Bezug auf erneuerbare Energien gilt.
In Schwellenmärkten, in denen dies nicht umsetzbar ist, wäre der Erwerb von CO2-Kompensationen nach einem anerkannten internationalen Standard eine alternative Möglichkeit, um während des Übergangs zu diesem Ziel kurzfristig ein operatives Netto-Null-Niveau zu erreichen.
Roland Hunziker, Direktor für gebaute Umwelt beim WBCSD, sagte: „Der Gebäudesektor ist für die Energiewende von entscheidender Bedeutung, da er mehr als die Hälfte des weltweiten Stroms verbraucht. Die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Umstellung auf erneuerbare Energien sind zwei Seiten derselben Medaille, um betriebsbereite Gebäude mit Netto-Null-Emissionen in großem Maßstab entsprechend der verfügbaren Kapazität zu erreichen.“
3 Gebäude, die die beste Netto-Null-Praxis demonstrieren
Der Bericht hob außerdem zehn Beispiele für Gebäude hervor, die beim Übergang zu Netto-Null-Emissionen im Betrieb Best Practices aufweisen. Dazu gehören:
Acciona Campus Gebäude 7
 Digitales Rendering des Acciona Campus-Gebäudes 7, Madrid, Spanien (Bild: Fenwick Ibarren Architects)
Digitales Rendering des Acciona Campus-Gebäudes 7, Madrid, Spanien (Bild: Fenwick Ibarren Architects)Der spanische Infrastrukturriese Acciona hat auf seinem Campus im spanischen Madrid das „Gebäude 7“ errichtet, das sich in der Endphase der Zertifizierung für den LEED v4.1- Standard für Design und Konstruktion sowie für die WELL v2- Platin-Zertifizierung befindet.
Das bisherige Gebäude auf dem Gelände wurde abgerissen und ein neues Gebäude unter Verwendung von 90 % des Bauschutts vor Ort errichtet. Gebäude 7, das Anfang dieses Jahres bezogen wurde, verfügt über eine Geothermieanlage zur Versorgung der Klimaanlage und eine Photovoltaikanlage, die jährlich 104 MWh erneuerbare Energie erzeugt.
Das Gebäude hat praktisch einen Null-Energie-Verbrauch (nZEB) und produziert laut Bericht 5,19 kg CO2/m2/Jahr.
Skanksas Hyllie Terrass, Malmö, Schweden
 Hyllie Terrace, Malmö, Schweden (Bild: Skanska)
Hyllie Terrace, Malmö, Schweden (Bild: Skanska)Skanska hat das Hyllie Terrass-Gebäude vor Baubeginn im Jahr 2020 entworfen und die Mieter begannen in diesem Jahr einzuziehen.
Das Gebäude ist Teil des Bestrebens des schwedischen Bauunternehmens, bis 2045 im eigenen Betrieb und in der gesamten Wertschöpfungskette keine CO2 -Emissionen mehr zu verursachen.
Das 12-stöckige Gebäude selbst ist Teil der Pilotstudie des Sweden Green Building Council zur Zertifizierung von Gebäuden mit Netto-Null -CO2- Emissionen.
Das Gebäude zeichnet sich durch Recyclingbeton und recycelten Baustahl aus. Die Baustelle ist frei von fossilen Brennstoffen. Skanska forderte außerdem Lieferanten und Subunternehmer auf, ihren Klima-Fußabdruck zu berechnen und zu melden.
Bullitt Center, Seattle, Washington
 Bullitt Center, Seattle, Washington, USA (Bild: Joe Mabel über Wikimedia Commons)
Bullitt Center, Seattle, Washington, USA (Bild: Joe Mabel über Wikimedia Commons)Das Bullitt Center hat vom International Living Future Institute (ILFI) die Living Building-Zertifizierung erhalten. Es wurde 2013 eröffnet und nutzt vollelektrische reversible Wärmepumpen zum Energieaustausch zwischen dem Gebäude und 120 m unter der Erde, um das Gebäude im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen.
Außerdem verfügt es über eine Reihe von Photovoltaik-Solarmodulen auf dem Dach, die 230 MWh Strom pro Jahr erzeugen. Es gibt vor Ort ein System, das Regenwasser in Trinkwasser umwandelt, und es gibt auch Komposttoiletten.
Bleiben Sie verbunden



Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.
Mit dem Team verbinden