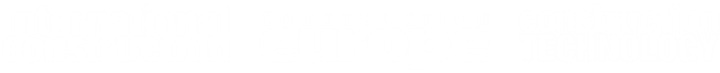Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Warum die Gebäudeplanung mit der Klimarealität Schritt halten muss
28 Juli 2025
 Bild mit freundlicher Genehmigung von IES
Bild mit freundlicher Genehmigung von IESDon McLean, CEO des globalen Klimatechnologieunternehmens IES, erklärt, warum ein neuer Bericht zum Klimawandel in Großbritannien zeigt, dass der Bausektor dringend seinen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten muss.
Der jüngste Klimabericht des Vereinigten Königreichs ist eine weitere deutliche Erinnerung an das Tempo des Klimawandels – und an die zunehmende Dringlichkeit, dass die gebaute Umwelt ihren Beitrag zu seiner Bekämpfung leistet. Die letzten drei Jahre gehörten zu den fünf wärmsten Jahren in Großbritannien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1884, wobei 2024 offiziell das viertwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1884 war. Im letzten Jahrzehnt war es in Großbritannien etwa 1,24 °C wärmer als im Durchschnitt von 1961 bis 1990, und die heißesten Sommertage und kältesten Winternächte erwärmen sich in einigen Teilen des Landes etwa doppelt so schnell wie im saisonalen Durchschnitt. Diese Rekordtemperaturen sind keine Seltenheit mehr; sie werden schnell zur Norm.
Doch dies ist nicht nur eine britische Geschichte. Klimaextreme – von Hitzewellen und Stürmen bis hin zu unvorhersehbaren Wetterlagen – sind mittlerweile weltweite Realität. Die Herausforderungen für die Bauindustrie sind ebenso universell: Ein Großteil der weltweiten Infrastruktur wurde für ein Klima konzipiert, das heute nicht mehr existiert. Gebäude stehen zunehmend unter dem Druck von Bedingungen, für die sie ursprünglich nicht gebaut wurden. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf, insbesondere für die Kühlung in Gebieten, in denen dies bisher nicht erforderlich war, weiter an.
Viele Gebäude sind nicht nur schlecht auf veränderte Bedingungen vorbereitet, sondern verursachen auch 37 % der weltweiten energiebezogenen Emissionen. Da die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oft Vorrang hat, bleibt die Bereitstellung von Gebäuden, die unter realen Bedingungen konstant funktionieren, eine Herausforderung. Da der Klimawandel die Umgebung, in der Gebäude betrieben werden, weiter verändert, sind weiterentwickelte Branchenansätze der Schlüssel zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit und zum Erreichen langfristiger Nachhaltigkeitsziele.
Was muss sich ändern?
Was muss sich ändern? Erstens müssen sich Planungsprozesse von der statischen Konformitätsmodellierung hin zu dynamischen, leistungsbasierten Analysen entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden berücksichtigen. Jede wichtige Planungsentscheidung – von der Standortausrichtung über die Fassadengestaltung und die Verglasungsverhältnisse bis hin zur Belüftungsstrategie – hat erhebliche Auswirkungen auf Energieverbrauch, thermischen Komfort, Belastbarkeit und sogar das Wohlbefinden der Bewohner. Doch allzu oft werden diese Entscheidungen ohne ausreichende Voraussicht hinsichtlich der tatsächlichen Leistung eines Gebäudes nach der Belegung getroffen.
 Don McLean, CEO von IES
Don McLean, CEO von IESZweitens müssen wir die Modellierung der Gebäudeleistung bereits in den frühesten Planungsphasen integrieren und sie über die gesamte Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsphase hinweg fortführen. Nur so lässt sich die sogenannte „Leistungslücke“ zuverlässig schließen – die allzu häufige Realität, dass Gebäude zwei- bis fünfmal mehr Energie verbrauchen als prognostiziert.
Obwohl das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen wächst und viele Bauunternehmen gute Absichten und hohe Ziele in Bezug auf Dekarbonisierung und Energieeffizienz haben, hinkt die Branche in mancher Hinsicht leider noch hinterher. Standards wie der britische Net Zero Carbon Buildings Standard und Initiativen wie die RIBA 2030 Climate Challenge haben ehrgeizige Ziele gesetzt. Doch ohne frühzeitige Leistungsmodellierung und eine umfassende Veränderung der Zusammenarbeit der Planungsteams von Anfang an laufen diese Ziele Gefahr, zu einer bloßen Abhakübung zu verkommen, anstatt in der Praxis zu einem sinnvollen Wandel zu führen.
Energiemodellierung sollte kein nachträglicher Gedanke sein
Bei zu vielen Projekten wird die Energiemodellierung noch immer als nachträglicher regulatorischer Aspekt behandelt – oft erst bei der Detailplanung oder nach der Bauphase, wenn der Spielraum für sinnvolle Änderungen begrenzt ist. Dieser Ansatz verpasst die Chance, die Planung von Anfang an zu optimieren, und führt oft zu betrieblichen Ineffizienzen oder der Notwendigkeit von Nachrüstungen im weiteren Verlauf.
Ein Projekt, das den Wert eines leistungsorientierten Ansatzes demonstriert, ist 2 Aldermanbury Square, ein großes Londoner Bürogebäude unter der Leitung von GPE. Mithilfe der IES-Leistungssimulationstechnologie wurde der betriebliche Energieverbrauch des Gebäudes gemäß dem NABERS UK Design for Performance-Prozess modelliert – eine Abkehr vom konformitätsorientierten Design hin zu realitätsnahen Leistungsergebnissen.
Ein detaillierter digitaler Zwilling wurde erstellt, um die Auswirkungen architektonischer und gebäudetechnischer Entscheidungen zu bewerten und den Energieverbrauch durch einen Fassaden-First-Ansatz und hocheffiziente, vollelektrische HLK-Systeme zu optimieren. Die Modellierung zeigt, dass das Gebäude auf dem besten Weg ist, die Anforderungen für eine NABERS UK 5-Sterne-Bewertung zu übertreffen und im Vergleich zu typischen britischen Bürogebäuden über 50 % Energieeinsparungen zu erzielen. Das Projekt zeigt, wie Simulationen im Frühstadium zu effizienteren, widerstandsfähigeren Gebäuden mit messbaren Ergebnissen führen können.
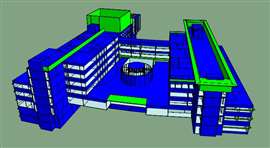 Bild mit freundlicher Genehmigung von IEL
Bild mit freundlicher Genehmigung von IELGroße Chancen ergeben sich jedoch auch in der Verbesserung bestehender Gebäude. Da 80 % der heutigen Gebäude voraussichtlich bis 2050 noch genutzt werden, ist die Nachrüstung des Bestands ein entscheidender Schritt zur Dekarbonisierung.
Und das kann sich durchaus auszahlen. An der Universität Liverpool beispielsweise konnte durch eine kürzlich erfolgte Modernisierung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik in Kombination mit Leistungsmodellen und Live-Überwachung in weniger als einem Jahr eine Energieeinsparung von 23 % erzielt werden. Bei der irischen Tifco Hotel Group ergaben detaillierte Energieaudits in neun Hotels eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen, mit denen sich der Energieverbrauch um 50 % und die CO₂-Emissionen um 43 % senken lassen. In Dublin konnte der Stadtrat mithilfe einer CO₂-Analyse über die gesamte Lebensdauer feststellen, dass eine umfassende Sanierung leerstehender Wohnblöcke über einen Zeitraum von 60 Jahren kumulative CO₂-Einsparungen von bis zu 85 % bringen könnte.
Diese Projekte zeigen, dass die Nachrüstung auf Grundlage solider Daten und Analysen ein praktischer und effektiver Weg zur Emissionsreduzierung und Leistungssteigerung des bestehenden Gebäudebestands sein kann.
Wenn die Baubranche den Klimawandel ernsthaft bekämpfen will, ist ein Wandel in der Gebäudeperformance unerlässlich. Sie muss zu einem zentralen Bestandteil jedes Projekts werden, Designentscheidungen beeinflussen, Zusammenarbeit ermöglichen und sicherstellen, dass alle Gebäude sowohl die Klimaresilienz- als auch die Dekarbonisierungsziele erfüllen.
Die Klimakrise ist keine ferne Bedrohung mehr, und um ihr zu begegnen, bedarf es gemeinsamen Handelns in der gesamten Baubranche. Intelligentere, datenbasierte Planung und Nachrüstung, unterstützt durch robuste, physikbasierte Leistungsmodelle, bieten einen klaren Weg nach vorn. Da die Risiken für Vermögenswerte steigen und das Potenzial für CO2- und finanzielle Einsparungen schwindet, ist dies ein Wandel, den die Branche nicht aufschieben darf.
Don McLean ist CEO des globalen Klimatechnologieunternehmens IES
Bleiben Sie verbunden



Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.
Mit dem Team verbinden