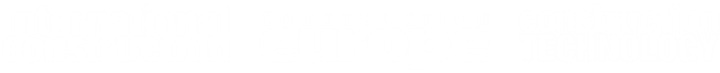Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Ist Konnektivität die Zukunft des Bauwesens?
14 Dezember 2023
Die Baustelle der Zukunft birgt das Potenzial einer Vernetzung, die die Produktivität steigert, Ineffizienzen reduziert, die Sicherheit verbessert und eine genauere Vorhersage der Projektkosten ermöglicht.
Um eine solche Zukunft zu erreichen, sind allerdings zunächst erhebliche Veränderungen der traditionellen Beschaffungs-, Liefer- und Geschäftsmodelle erforderlich, bevor dies Wirklichkeit werden kann.

Einer der wichtigsten Aspekte ist die Sicherstellung der richtigen Mischung von Konnektivitätsstandards, was möglicherweise die Bewältigung von Lizenzierungsproblemen erfordert. Darüber hinaus müssen regulatorische Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Telekommunikation und Cybersicherheit, berücksichtigt werden.
Während sich die Branche an neue Arbeitsweisen gewöhnt, ist klar geworden, dass es keine einheitliche Definition dafür gibt, was eine vernetzte Baustelle eigentlich ist. Wir gehen in eine Zukunft, in der Technologie unsere Produktivität und Effizienz erheblich beeinflusst. Welches Potenzial bietet eine vernetzte Baustelle und welche Hindernisse stehen ihrer Einführung im Weg?
Datenvernetzung im Bauwesen
„Eine vernetzte Baustelle bedeutet traditionell, dass Geräte und Arbeiten über das Internet mit dem Büro verbunden sind, was verbesserte Arbeitsabläufe zwischen Büro und Baustelle ermöglicht. Aber es geht um mehr als das“, sagt Chris Richardson, Senior Director of Industry Workflows im Bereich zivile Infrastruktur bei Trimble.
„Konnektivität ist zwar eine grundlegende Voraussetzung für die Verbesserung der Bauausführung, der wahre Wert entsteht jedoch erst, wenn Sie beginnen, die Daten mit der Baustelle zu verknüpfen; das Digitale wirklich mit dem Physischen zu verbinden. Verknüpfen Sie das Design mit den Zahlungspositionen im Vertrag und mit dem Fortschritt und den Kosten der ausgeführten Arbeiten, während diese ausgeführt werden.“
 Richard Clement, stellvertretender Geschäftsführer bei Smart Construction (Foto: Smart Construction)
Richard Clement, stellvertretender Geschäftsführer bei Smart Construction (Foto: Smart Construction)Für Richard Clement, stellvertretender Geschäftsführer von Smart Construction, bedeutet die vernetzte Baustelle die Schaffung eines digitalen Zwillings der physischen Baustelle, auf der Menschen, Maschinen und Materialien miteinander vernetzt sind.
„Durch die Nutzung von Echtzeitdaten zu Gelände, Maschinen, Menschen und Materialien können datengesteuerte Entscheidungen getroffen werden, die die Sicherheit erhöhen, die Produktivität steigern und die Gewinnspannen verbessern“, kommentiert er.
„Eine der größten Herausforderungen bei Erdbewegungsarbeiten ist die Unvorhersehbarkeit dessen, was sich unter der Oberfläche befindet. Trotz sorgfältiger Planung treten nach Beginn der Grabarbeiten oft unerwartete Bedingungen auf, die die ursprünglichen Pläne durchkreuzen.“
Anstatt sich lediglich mit unvorhergesehenen Umständen auseinanderzusetzen, wenn diese auftreten, bietet eine vernetzte Site eine dynamischere Lösung: Sie überwacht die Site-Aktivitäten, bewertet etwaige Abweichungen und passt den Plan entsprechend an. So wird eine kontinuierliche Anpassung an die Projektanforderungen sichergestellt.
Ein adaptiver Ansatz ermöglicht eine proaktivere Entscheidungsfindung vor Ort, sei es bei der Änderung von Prioritäten und Neupositionierung von Geräten, der Einführung zusätzlicher Maschinen oder der Änderung der Ressourcen vor Ort.
Clement fügt hinzu: „Diese Fähigkeit, dynamisch auf sich ändernde Baustellenbedingungen zu reagieren, anstatt unangepasst weiterzumachen, ist der entscheidende Vorteil einer vernetzten Baustelle.“
Kultureller Technologiewandel
Die Baubranche hat sich bei der Einführung digitaler Technologien traditionell zurückgehalten, aber dafür gibt es gute Gründe, sagt Clement. „Wenn die Marge gering ist, sind die Leute eher für ‚sichere‘ Arbeitsmethoden und viele bleiben trotz potenzieller Effizienzgewinne lieber bei vertrauten Prozessen“, sagt er.
Clement schlägt vor, die Einführung neuer Technologien mit einem sie unterstützenden kulturellen Wandel zu begleiten.
„Dieser Wandel kann durch erhebliche Chancen vorangetrieben werden, die die wahrgenommenen Risiken überwiegen. Auch staatliche Stellen und große Kundenorganisationen können bei diesem Übergang eine entscheidende Rolle spielen. Indem sie den Einsatz digitaler Technologien in Verträgen für Infrastrukturprojekte wie Straßen und Eisenbahnen vorschreiben, können sie eine breitere Akzeptanz unter den Auftragnehmern fördern.“
Das wahre Potenzial der vernetzten Baustelle erschließt sich letztlich aus der Beobachtung, wie Bauunternehmer tatsächlich mit digitalen Lösungen arbeiten. Nur durch diese direkte Beobachtung wird klar, ob diese Tools tatsächlich eingesetzt werden, um die erwarteten Kosteneinsparungen zu erzielen.
Holger Pietzsch, der zuvor bei Hexagon war und kürzlich eine neue Rolle bei Moog Construction übernommen hat, stimmt zu, dass es mehrere Hindernisse gibt. „Ich denke, heute werden viele Technologien unabhängig voneinander entwickelt. Interoperabilität und Kompatibilität sind bei Hardware, Software und Daten nicht immer gegeben.“

Pietzsch fügt hinzu, dass es zwar hervorragende Technologien auf dem Markt gebe, diese aber häufig proprietär seien. Das sei nicht gut für Auftragnehmer, die mit Maschinen unterschiedlicher Marken oder unterschiedlicher Softwaretypen arbeiten, sagt er.
Richardson von Trimble schließt sich Pietzschs Ansicht an und sagt, dass ein wesentliches Hindernis für die Einführung vernetzter Baustellen darin besteht, dass „die Daten in isolierten Arbeitsabläufen in proprietären Softwaretools gefangen sind, was den Betrieb einer wirklich vernetzten Baustelle in der Vergangenheit erschwert hat.“
Daten integrieren
Die gute Nachricht ist, dass sich dies ändert, da die Anbieter Integrationen und Cloud-basierte Softwareplattformen bereitstellen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Daten und Arbeitsabläufe zu integrieren.
Dies führt jedoch zu einem weiteren Problem – dem Fachkräftemangel. „Im digitalen Zeitalter des Bauwesens, in dem wir uns jetzt befinden, werden Mitarbeiter mit Software- und Integrationskenntnissen dringend benötigt, was zu einer großen Nachfrage nach qualifiziertem Ingenieurpersonal mit Softwareentwicklungskenntnissen führt“, sagt Richardson.
Pietzsch stimmt zu, dass der Fachkräftemangel eine große Hürde für eine erfolgreiche Einführung darstellt. „Die Baubranche hat immer noch einen Ruf, der sie für viele junge Talente nicht gerade zu einer attraktiven Branche macht“, sagt er.
Jeroen Snoeck, Dealer Solution Manager für Europa bei Volvo CE, ist davon überzeugt, dass neue Technologien tatsächlich eine Änderung der Denkweise erfordern. „Es kann manchmal eine Herausforderung sein, dafür zu sorgen, dass jeder vor Ort bereit ist, die Vorteile einer vernetzten Baustelle zu nutzen.
„Wir wissen, dass Veränderungen schwer sind, wenn man über viele Jahre hinweg auf eine bestimmte Art und Weise gearbeitet hat. Deshalb stellen wir stets sicher, dass sich unsere digitalen Lösungen so einfach wie möglich in die Betriebsabläufe unserer Kunden integrieren lassen.“
 Jeroen Snoeck, Dealer Solution Manager für Europa, Volvo CE (Foto: Volvo CE)
Jeroen Snoeck, Dealer Solution Manager für Europa, Volvo CE (Foto: Volvo CE)Evolution-Konnektivität
Trotz dieser Hindernisse besteht Optimismus, dass sich die Technologie so weiterentwickeln wird, dass sie den Anforderungen moderner Baustellen auf der ganzen Welt gerecht wird.
Richardson von Trimble ist davon überzeugt, dass die nächste Entwicklung rund um die vernetzte Baustelle davon abhängt, wie die Daten auf der Baustelle genutzt werden. Da die Baustelle durch die Integration von Daten und zugehörigen Arbeitsabläufen immer leistungsfähiger wird, könnte die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens (ML) eine entscheidende Chance darstellen.
„Mithilfe dieser Tools kann der Auftragnehmer Prognosen automatisieren, Zeitpläne optimieren und sich während der Arbeit ein besseres Bild vom Zustand seiner Projekte machen“, sagt Richardson.
Bauunternehmer werden bei der Gestaltung der Zukunft einer vernetzten Baustelle eine Schlüsselrolle spielen, aber welche Rolle können OEMs spielen?
Clement von Smart Construction weist darauf hin, dass die Verwirklichung einer vollständig vernetzten Baustelle – sei es heute oder in Zukunft – nicht allein in der Verantwortung des Bauunternehmers liegt. Auch OEMs müssen ihren Teil dazu beitragen, indem sie Lösungen bereitstellen, die einheitlichen Standards entsprechen.
„Auch staatliche Stellen müssen ihren Teil dazu beitragen“, sagt Clement. „Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von allen Seiten. Nur wenn Synergien bei der Arbeit an der digitalen Weiterentwicklung entstehen, werden vernetzte Arbeitsplätze allgemein realisierbar.“

Auswirkungen der Elektrifizierung
Die Standardisierung wird ein wesentlicher Treiber für die Einführung vernetzter Baustellen sein.
„Ich denke, es wird mehr Standardisierung geben“, ist Pietzsch überzeugt. „Außerdem wird es mehr Effizienz geben, was letztlich den CO2-Fußabdruck verringern wird. Indem wir die Effizienz verbessern, werden wir auch das Endergebnis für viele Auftragnehmer verbessern.“
Pietzsch betont, dass die Elektrifizierung einen positiven Beitrag zur Konnektivität leisten wird. „Ich denke, sie hilft sehr“, sagt er. „Denn elektrifizierte Systeme sind besser maschinenlesbar, besser programmierbar und besser im Hinblick auf unseren CO2-Fußabdruck.“
Neben den Umweltvorteilen ist Snoeck von Volvo CE davon überzeugt, dass eine weiterentwickelte vernetzte Baustelle das Potenzial hat, die Sicherheit zu erhöhen und eine nahtlose Arbeitsumgebung zu schaffen.
„Die ultimative Vision ist, dass alle Prozesse optimal funktionieren und die Sicherheit 100 % beträgt. Um dies in einem bestehenden Betrieb zu erreichen, ist es hilfreich, in kleinen Schritten zu arbeiten, was wir bei Volvo CE als ‚Microservices‘ bezeichnen.
„Durch jede Verbesserung im Betrieb lernen der Standortleiter und sein Team, effizienter und sicherer zusammenzuarbeiten. Der Grad der Veränderung ist je nach Standort unterschiedlich; auf Greenfield-Standorten kann man beispielsweise schneller vorgehen und den Betrieb so gestalten, dass von Anfang an ein schlanker Betrieb umgesetzt werden kann.“
Der Einsatz eines aktualisierten digitalen Zwillings für alle Baustellen ermöglicht der Branche eine präzise Visualisierung, Planung und Ausführung.
„Anstatt den digitalen Zwilling als reaktives Tool zur Fehlerbehebung zu verwenden“, erklärt Clement. „Er kann proaktiv in der Planungsphase eingesetzt werden. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass Projekte mit Zuversicht ausgeführt werden, da man weiß, dass die Pläne sowohl gut durchdacht als auch umsetzbar sind.“
Hilti erweitert Trackunit-Plattform um 500.000 Tags

Der IoT-Dienstleister Trackunit hat seine Beziehung zum globalen OEM Hilti gestärkt, indem er seinem globalen Netzwerk von Bluetooth-Gateways mehr als 500.000 Hilti On!Track-Tags hinzugefügt hat.
Hilti gibt an, dass Benutzer durch diese Partnerschaft nun eine bessere Sichtbarkeit ihrer Hilti-Werkzeuge haben und ihre mit ON!Track gekennzeichneten Hilti-Werkzeuge über eine App auf dem Trackunit Marketplace im Trackunit Manager sehen können.
„Durch die Integration der Hilti ON!Track-Tags in das umfangreiche Netzwerk von Trackunit haben wir nicht nur die Sichtbarkeit und Verwaltung unserer Werkzeuge verbessert, sondern auch das Betriebserlebnis unserer Kunden optimiert“, sagte Michael Neidow, EVP der Construction Software Unit von Hilti.
Das in Liechtenstein ansässige Unternehmen Hilti unterhält seit Januar 2022 eine strategische Partnerschaft mit Trackunit und entwickelt seine Telematiklösung auf Grundlage der Telematikfunktionen und des globalen Netzwerks von Trackunit.
„Indem wir unser globales Bluetooth-Netzwerk für Hilti On!Track geöffnet und unsere Hilti Marketplace-App eingeführt haben, haben wir eine umfassende Lösung geliefert, die unseren gemeinsamen Kunden einen einfachen Zugriff auf wichtige Werkzeugdaten ermöglicht“, sagte Soeren Brogaard, CEO von Trackunit. „Wir sind sehr gespannt auf die zukünftigen Fortschritte, die diese Zusammenarbeit der Baubranche bringen wird.“
Bleiben Sie verbunden



Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.
Mit dem Team verbinden