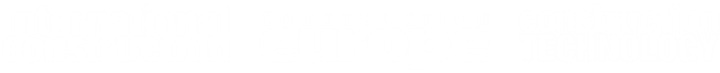Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Wie DST und Tagregados den Steinbruch von Gouvães zerstörten
11 Juni 2024
D&Ri spricht mit DST (Domingos da Silva Teixeira) und Tagregados, beide Teil der DST Group, über den jüngsten Abriss und die Sanierung des Gouvães-Steinbruchs in Portugal.
Tief im Norden Portugals liegt im geschützten, 600 km² großen Natura 2000-Gebiet Alvão/Marão ein wunderschöner, grüner Lebensraum in der Seenlandschaft, der aussieht, als wäre er schon immer dort gewesen.
Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Stausee, den Gouvães-Stausee. Dieser existiert erst seit einem Jahr und wurde durch den Bau des Gouvães-Staudamms und den Abriss und die Sanierung des Gouvães-Steinbruchs geschaffen.
 DST und Tagregados, beide Teil der DST Group, haben den Steinbruch Gouvães in Portugal abgerissen und saniert. (FOTO: DST)
DST und Tagregados, beide Teil der DST Group, haben den Steinbruch Gouvães in Portugal abgerissen und saniert. (FOTO: DST)
Über den Steinbruch Gouvães
Der Steinbruch wurde eigens errichtet, um dem Energieriesen Iberdrola den Bau von drei Wasserkraftwerken an den Flüssen Tâmega und Torno im Einzugsgebiet des Douro zu ermöglichen, die zusammen 6 % des Energiebedarfs des Landes decken würden.
Daher unterlagen der Bau, der Betrieb und die spätere Stilllegung der Steinbruchanlagen strengen Umweltschutzbestimmungen.
Von Anfang an stand die strenge Aufsicht der portugiesischen Behörden, der DGEG (Generaldirektion für Energie und Geologie), der APA (portugiesische Umweltagentur), des ICNF (Institut für Natur- und Waldschutz) und der CCDR-N (Kommission für die Koordinierung und Entwicklung der nördlichen Region) im Mittelpunkt des Projekts.
Am Ende der achtjährigen Betriebszeit des Steinbruchs – in der Zwischenzeit hatte er Zuschlagstoffe für die drei Wasserkraftwerke produziert – wurde ein komplexes Rückbauverfahren durchgeführt, um den von der Genehmigungsbehörde genehmigten Plan zur Umweltsanierung umzusetzen.
Daher unterlagen Bau, Betrieb und Stilllegung von Anfang an strengen Vorschriften und der Aufsicht der portugiesischen Generaldirektion für Energie und Geologie (DGEG), der portugiesischen Umweltagentur (APA), des Instituts für Natur- und Waldschutz (ICNF) und der Kommission für die Koordinierung und Entwicklung der nördlichen Region (CCDR-N).
Am Ende der achtjährigen Betriebsdauer des Steinbruchs wurde ein komplexes Rückbauverfahren durchgeführt, um den genehmigten Umweltsanierungsplan umzusetzen.
Umfang der Arbeiten
Der 27 Hektar große Steinbruch umfasste eine 8 Hektar große Brechanlage mit zehn Sieben, einem Backenbrecher, zwei Kegelbrechern, einem Brecher mit vertikaler Welle, 1,5 Kilometer Förderbändern und sechs Lagersilos.
 Von der anderen Seite des Flusses Torno ist der Fangedamm rund um die Steinbruchanlage zu sehen. (FOTO: DST)
Von der anderen Seite des Flusses Torno ist der Fangedamm rund um die Steinbruchanlage zu sehen. (FOTO: DST)
Zwei Seiten der Steinbruchanlage wurden von einem riesigen Fangedamm aus HDPE-Folie (Polyethylen hoher Dichte), zwei Lagen Geotextil, Erde und einer Stützmauer aus Steinschüttungen umgeben, um den Steinbruch vor dem Wasser des Stausees zu schützen.
Während der Hauptaufgabenbereich von DST im Bau der Steinbruchanlagen und der Produktion der Zuschlagstoffe für den Bau der Wasserkraftwerke lag, war das Unternehmen auch für die Schließung des Steinbruchs am Ende des Infrastrukturprojekts verantwortlich.
Somit stellte die Räumung und Wiederherstellung des Geländes eine besondere Herausforderung für den Hauptauftragnehmer DST dar.
Die größte Herausforderung bestand darin, die Arbeiten innerhalb von nur drei Monaten abzuschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschloss DST, den Abriss und die Sanierung in zwei getrennten Phasen durchzuführen.
In der ersten Phase würden sämtliche Einrichtungen, Geräte, Anlagen und Bauwerke vom Gelände vollständig entfernt; im selben Zeitraum würden auch die Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt.
Nach der Reservoirprüfung durch Iberdrola würde die zweite Phase den Abbau des Fangedamms umfassen – der letzten künstlichen Struktur auf dem Gelände.
Räumung eines Steinbruchgeländes
DST begann die erste Phase des Projekts mit der Aufteilung des Geländes in vier unterschiedliche Zonen, um gleichzeitig die Silos entfernen und die Anlagen, Geräte, Infrastruktur und Hilfseinrichtungen räumen zu können.
 Die demontierte Steinbruchanlage und -ausrüstung füllte 150 Schiffscontainer. (FOTO: DST)
Die demontierte Steinbruchanlage und -ausrüstung füllte 150 Schiffscontainer. (FOTO: DST)
Nuno Faria, Projektmanager bei der DST Group, sagt: „Der gesamte Stahl aus dem Werk musste sorgfältig demontiert werden, da er zur Verwendung in einem anderen Steinbruch nach Angola transportiert werden sollte.
„Insgesamt füllten die Anlagen und Geräte 150 40-Fuß-Container. Es war also eine ziemliche logistische Herausforderung.“
Schweres Heben: Demontage riesiger Strukturen
Ein wesentlicher Teil dieser ersten Phase des Abbruchprojekts war der Abbau der sechs Silos des Standorts, in denen 12.000 t Zuschlagstoffe gelagert wurden.
Die Silos waren 30 m hoch und hatten einen Basisdurchmesser von 9 bis 11 m. Sie standen auf einer Stahlbetonplatte.
„Jedes Silo bestand aus zwölf Metallringen mit einer Höhe von 2 m. Jede Ringschicht bestand aus mehreren Stahlplatten, die miteinander und mit dem nächsten Ring verschraubt waren“, sagt Nuno. „Für die Montage der Silos verwendeten wir einen Kran, um zu testen, wie man sie am besten zusammenbaut.“
„Zuerst haben wir versucht, Stück für Stück, Ring für Ring, einen Silo aufzubauen. Und damals dachten wir, dass dies auch der einfache Weg wäre, die Silos abzubauen.
„Wir stellten jedoch schnell fest, dass dies die Form der Metallringe verformen könnte.
„Und da die Silos sowie die gesamte andere Anlage und Ausrüstung an einen anderen Standort gebracht und wiederverwendet werden sollten, konnten wir das nicht riskieren.“
Nuno sagt: „Zudem wäre es innerhalb des dreimonatigen Zeitrahmens, der uns für den Abriss zur Verfügung stand, nicht möglich gewesen, sie Stück für Stück abzubauen.“
Am Ende montierte DST jeden Silo direkt auf der Platte, wiederum einen Ring nach dem anderen, aber nur bis zur Hälfte ihrer Gesamthöhe.
Währenddessen montierte ein zweites Team die obere Hälfte jedes Silos auf dem Boden und hob sie anschließend auf die untere Hälfte des Silos, die sich bereits auf der Platte befand.
„Dadurch erhielten wir konkrete Hinweise, wie wir die Demontagearbeiten später beschleunigen könnten“, sagt Nuno.
„Unter Berücksichtigung der maximalen Tragkraft des Krans haben wir uns entschieden, die Silos nicht in zwei, sondern in drei Abschnitten abzubauen. Dabei besteht jeder Abschnitt aus etwa vier Ringlagen.“
Nuno fügt hinzu, dass die strukturelle Integrität der Silos ein wichtiger Aspekt beim Rückbau gewesen sei, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast acht Jahren im Einsatz gewesen seien.
„Wir wussten nicht, wie sich der Verschleiß der Silos auf ihre Struktur ausgewirkt hatte. Als wir sie also entfernen mussten, mussten wir besonders vorsichtig sein.“
 DST baute eine speziell konstruierte Querstrebe, die es dem Kran ermöglichte, große Teile der sechs Silos des Steinbruchs sicher zu handhaben. (FOTO: DST)
DST baute eine speziell konstruierte Querstrebe, die es dem Kran ermöglichte, große Teile der sechs Silos des Steinbruchs sicher zu handhaben. (FOTO: DST)
„Um das Problem der Verformung der Strukturen zu lösen, haben wir eine stützende Querstrebe entworfen, die am Kran befestigt wurde“, erklärt Nuno.
„Die Konstruktion ermöglichte eine Anbindung an die Ringlagen der Silos über vier Befestigungspunkte und berücksichtigte dabei die Silosdurchmesser von 9, 9,5 und 11 Metern.
„Die Querstrebe war sehr wichtig, um einerseits die Last zu verteilen und andererseits zu verhindern, dass sich die Ringform der Siloschichten verformt.
„Ja, wir haben etwas Zeit mit der Vorbereitung und dem Studium verloren, aber es hat auch die Geschwindigkeit, mit der wir die Strukturen zum Einsturz bringen konnten, deutlich erhöht.
„Und das war von entscheidender Bedeutung dafür, dass wir die Arbeiten innerhalb des kurzen Zeitfensters von drei Monaten abschließen konnten, da wir wussten, dass der Abriss der Platte, auf der die Silos gestanden hatten, viel Zeit in Anspruch nehmen würde.
„Die Entwicklung der Querstrebe erwies sich als echte Wende.“
Eine DST-Einsatzgruppe aus 20 Abbrucharbeitern war nötig, um den Abbau mit zwei Teleskopkränen, vier Hebebühnen, einem Baggerlader, zwei Gabelstaplern und einem Kranwagen abzuschließen.
Entfernen von Stahlbetonkonstruktionen
Nach der Entfernung der Silos konnte Tagregados, die auf Abbruch, Sprengung und Bohren spezialisierte Abteilung der DST Group, die Betonplatte, auf der sie gestanden hatten, abreißen.
Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Fachunternehmer für die Fertigstellung der Aufgabe nur zwei Wochen Zeit, und am Ende erwies es sich als eines der schwierigsten Vorhaben des gesamten Projekts.
 Die Betonplatte war so stark, dass zwei Säulenpaare abgerissen werden mussten, um einen Bruch im gewölbten Dach zu verursachen. (FOTO: DST)
Die Betonplatte war so stark, dass zwei Säulenpaare abgerissen werden mussten, um einen Bruch im gewölbten Dach zu verursachen. (FOTO: DST)
„Auf den Fotos sieht es klein aus. Aber es war nicht klein“, sagt Diogo Fonseca, Geschäftsführer von Tagregados.
Tatsächlich war die Platte 60 m lang, 12 m breit und an ihren dicksten Stellen 1,5 m dick. Allein im oberen Abschnitt waren über 350 t Stahl und rund 1.200 m3 Beton verbaut.
„Wir haben vor dem Abbruch verschiedene Lösungen untersucht, darunter auch Diamantdrahtschneiden. Aber wir wussten nicht, wie das Diamantdrahtschneiden mit so viel Stahl zurechtkommen würde, und wir kamen zu dem Schluss, dass es auch zu lange dauern würde“, erklärt Diogo.
„Wir haben auch den Einsatz von Sprengstoff untersucht, um wichtige Schnitte zu erzeugen, mit denen die Struktur abgesenkt werden kann. Aber auch hier konnten wir angesichts der Stahlmenge in der Platte nicht mit Sicherheit sagen, wie das Ergebnis ausfallen würde.
„Um die Platte in den zwei Wochen, die uns zur Verfügung standen, abzureißen, war die einzige echte Möglichkeit, sie mechanisch abzureißen.“
Daher setzte Tagregados für diese Aufgabe sechs 36-t-Hydraulikbagger, zwei 24-t-Hydraulikbagger, einen mobilen Backenbrecher sowie zahlreiche Hydraulikhämmer, Multiprozessoren und Pulverisierer ein.
„Die obere Platte wurde von mehreren Säulensätzen getragen, die Abschnitte mit gewölbten Dächern stützten.
„An der dicksten Stelle war es 1,5 m dick und an den schmalsten Stellen 1 m. Daher dachten wir zunächst, dass die Bruchstelle erreicht wäre, wenn wir die ersten Pfeiler entfernen würden“, sagt Diogo.
 Trotz der Herausforderungen wurde die Platte zwei Tage früher als geplant vollständig entfernt. (FOTO: DST)
Trotz der Herausforderungen wurde die Platte zwei Tage früher als geplant vollständig entfernt. (FOTO: DST)
„Aber natürlich war die Struktur so stabil, dass sich die obere Platte nicht bewegte, als wir die ersten Pfeiler entfernten. Sie war nämlich dafür ausgelegt, die 30 m hohen Silos und die 12.000 t Zuschlagstoffe darin zu tragen. Sie war immer noch da. An ihren schmalsten, 1 m dicken Stellen war sie nämlich mit drei Lagen 32 mm starker Betonstahl verstärkt.
„Als wir also die ersten Pfeiler entfernten, passierte nichts. Erst als wir den zweiten Pfeilersatz entfernten, erreichten wir beim nächsten Bogendachabschnitt an seiner schmalsten Stelle (1 m) die Bruchstelle.
„Und dieses Bruchmuster wiederholte sich in jedem zweiten Abschnitt der Platte. Das war also ein klarer Beweis dafür, dass sie gut gebaut war. Sie war kugelsicher.“
 Tagregados‘ Bagger reißen die Siloplatte im Gouvães-Steinbruch ab. (FOTO: DST)
Tagregados‘ Bagger reißen die Siloplatte im Gouvães-Steinbruch ab. (FOTO: DST)
Nach einem wiederholten Zyklus aus Hämmern, Scheren, Pulverisieren und Zerkleinern, für den eine Fläche von fast 3 Hektar benötigt wurde, wurden der getrennte Stahl und Beton zum Recycling geschickt.
Laut Diogo dauerte der Abriss des Gebäudes und die Beseitigung des anfallenden Schutts nur zwölf Tage und lag damit deutlich innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens von zwei Wochen.
 Die entstandenen Betontrümmer wurden vor Ort zerkleinert und anschließend zum Recycling abtransportiert. (FOTO: DST)
Die entstandenen Betontrümmer wurden vor Ort zerkleinert und anschließend zum Recycling abtransportiert. (FOTO: DST)
Abbau eines Fangedamms
Der erfolgreiche Abriss der Platte und die anschließende Öffnung des Fangedamms (aus Sicherheitsgründen) markierten das Ende der ersten Phase des Abriss- und Restaurierungsprojekts.
Und nach einem dreimonatigen Zeitraum, in dem Iberdrola seine Tests des neu geschaffenen Gouvães-Stausees durchführte, begann DST mit der letzten Phase des Projekts: dem Abbau des riesigen Fangedamms, der den Steinbruch vor den Wassermassen des Stausees geschützt hatte.
 DST öffnete den Fangedamm, der die Steinbruchanlage einst an zwei Stellen umgab, um das Wasser des neu geschaffenen Gouvães-Stausees durchzulassen. (FOTO: DST)
DST öffnete den Fangedamm, der die Steinbruchanlage einst an zwei Stellen umgab, um das Wasser des neu geschaffenen Gouvães-Stausees durchzulassen. (FOTO: DST)
„Als wir die Arbeiten vor Ort wieder aufnahmen, hatten wir erneut nur zwei Wochen Zeit, um den Fangedamm zu entfernen“, sagt Nuno.
„Und weil der Stausee nun in Betrieb war, stieg und fiel der Wasserstand bis zu einem bestimmten Niveau.“
Der Fangedamm war über 0,5 km lang und 5 m hoch, mit einer Breite von bis zu 30 m an der Basis und einer Breite von 6 m oben.
 Der Fangedamm war über 0,5 km lang und bis zu 6 m hoch. (FOTO: DST)
Der Fangedamm war über 0,5 km lang und bis zu 6 m hoch. (FOTO: DST)
Es bestand aus Erde, einer Stützmauer aus Steinen, zwei Lagen Geotextil (1.200 und 300 g) mit einer dazwischen liegenden undurchlässigen HDPE-Folie, die die Außenseite (Wasserseite) der Struktur schützte.
Als der Wasserstand des Stausees seinen niedrigsten Stand erreicht hatte, wurde mit umfangreichen Erdbewegungsarbeiten begonnen und der Fangedamm wurde schließlich zwei Tage früher als geplant vollständig abgebaut.
Als das gesamte Wasserkraftwerksprojekt abgeschlossen war, wurde dieser Abschnitt des einst schmalen Flusses Torno in einen funktionierenden Stausee umgewandelt, der bei seinem Höchstwasserstand den größten Teil des Steinbruchgeländes von Gouvães bedecken würde.
„In ein paar Jahren werden Sie sehen, dass das gesamte Gebiet mit Vegetation bedeckt ist. Bäume, Büsche, Grasland und Wasser sind alles, was Sie sehen werden“, so Nuno abschließend.
Der Steinbruch wurde mit dem von der UEPG geförderten Europäischen Preis für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.
 Der Standort des ehemaligen Gouvães-Steinbruchs im Norden Portugals. (FOTO: DST)
Der Standort des ehemaligen Gouvães-Steinbruchs im Norden Portugals. (FOTO: DST)Bleiben Sie verbunden



Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.
Mit dem Team verbinden